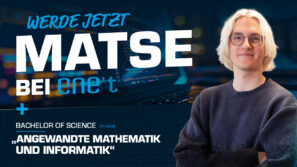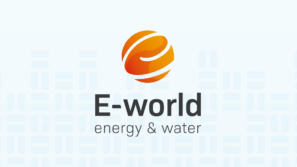Geschäftsführer Dipl.-Ing. Roland Hambach nutzte die Begrüßung, um den Angereisten den Firmenstandort vorzustellen. Die niederrheinische Stadt blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die lange Zeit vom Steinkohleabbau in der Zeche Sophia-Jacoba geprägt war. Die Auswirkungen durch allgegenwärtige Bergschäden zeigten sich auch in der Anekdote über eine Verwandte, die schiefe Gardinen nähte, damit die Fenster gerade aussahen. Nach dem Ende der Kohleförderung 1997 begann der Strukturwandel in der Region, der dank breiter politischer Unterstützung Raum für Innovationen eröffnete – auch ene't fand den ersten Firmensitz im neuangelegten Gründer- und Servicezentrum Hückelhoven.
Energiemarkt zwischen Risiken und Überregulierung
In seinem Jubiläumsjahr richtete der edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e. V. das „Kamingespräch“ für Expertinnen und Experten aus der Energiewirtschaft in den Räumlichkeiten der ene't aus. Die bereits 11. Auflage widmete sich dem Thema „Wieviel Regulierung braucht die Energiewende? Von Dynamischen Tarifen, 24h-Lieferantenwechsel bis zum MaBis-Hub“. Rund 35 Branchenkenner folgten der Einladung nach Hückelhoven.
Foto: Dipl.-Ing. Roland Hambach bei der Eröffnung des Kamingesprächs
Die Diskussionsrunde mit ausgewiesenen Branchenkennern entwickelte sich im Anschluss zu einem intensiven Austausch. Dr. Ralf Walther (Tibber Deutschland) beklagte eine Überregulierung: „Die Skandinavier schütteln nur den Kopf darüber, wie kleinteilig der Energiemarkt in Deutschland reguliert ist.“ Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge (Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln) kritisierte darüber hinaus falsche Anreize: „Alle wollen immer neu bauen, Kraftwerke, Speicher und mehr“. Dies sei aber nicht wirtschaftlich umsetzbar. Er sorgte sich zudem vor immer weiter wachsenden Regularien, was auch Anwältin Dr. Carmen Schneider (FPS Rechtsanwaltsgesellschaft) unterstrich: „Es wird immer noch mehr Regulierung oben aufgesetzt“. Ein gutes Beispiel sei die „Strompreisbremse“ gewesen, was von deutlichem Raunen im Publikum bestätigt wurde.
Über zu viel Regulierung im Energiehandel wusste auch Michael Ramczykowski (NEW Niederrhein Energie und Wasser) zu berichten, die Balance zwischen anzuwendenden Regeln und freiem Handel stimme nicht. „Es wird alles komplexer, und das wird auf dem Rücken der Kunden ausgetragen“, konstatierte er. Sebastian Limburg (NRW.Energy4Climate) kritisierte die Realitätsferne der Bundespolitik: „Die meinen es gut, machen es aber nicht gut.“ Größtes Problem sei die fehlende Kommunikation mit den betroffenen Marktakteuren.
Foto: Teilnehmende des Kamingesprächs, v.l. Bernhard Mildebrath (Moderation), Dr. Ralf Walther, Sebastian Limburg, Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Michael Ramczykowski, Dr. Carmen Schneider
Ohne Regulierung geht es nicht, waren sich die Teilnehmenden weitgehend einig, doch vieles sei zu kleinteilig geregelt und bremse Fortschritte aus. Mit Blick auf den Klimawandel mahnte Dr. Walther: „Wir können nicht einfach so weiter machen.“ Aber auch volkswirtschaftlich bringe dies Nachteile, wenn Deutschland beispielsweise als Standort unattraktiv werde für die Neuansiedlung von Rechenzentren internationaler Anbieter, weil erforderliche Netzanschlüsse nicht realisiert werden können, wie Limburg als Beispiel anbrachte.
Es folgte eine lebhafte Diskussion mit den Besuchern über die Fragen, wie wirtschaftlich der Zubau von erneuerbaren Energien ist, ob die Energiepolitik zu sehr von der Beraterlobby beeinflusst wird und ob die heutige Zahl an Energievertrieben womöglich zu groß ist. Weiter wurde darüber nachgedacht, wie sinnvoll der generelle Smart-Meter-Roll-out ist, wenn passende Geschäftsmodelle fehlen, bevor das Kamingespräch als eines der bisher längsten sein Ende im persönlichen Austausch der Gäste fand.
Am Folgetag schloss sich das „edna Fachtreffen“ mit fünf praxisnahen Vorträgen an. Zu Beginn warf Bernhard Mildebrath (Schleupen) einen Blick zurück auf „200 Jahre Energiewirtschaft in Deutschland“ und einen nach vorn auf das anstehende 25-jährige Jubiläum des Bundesverbands im Dezember. Mildebrath würdigte die Energiewirtschaft als eine der innovativsten Branchen der Geschichte und erinnerte an die Anfänge: „Es begann mit Licht.“ Die ersten Gaslaternen legten den Grundstein für die frühen Gaswerke, in denen für den Betrieb „Stadtgas“ aus Steinkohle gewonnen wurde. Die erste reguläre Gasversorgung diente der Beleuchtung einer Fabrikhalle: „Die junge Energiewirtschaft hat es geschafft, Licht in das Dunkel zu bringen.“ Aus diesen Anfängen entwickelten sich in 200 Jahren große Konzerne, völlig neue Berufsbilder und nicht zuletzt auch die Konzessionsabgabe als einträgliche Einnahmequelle der Kommunen.
Oliver Kunz (ene't) beschäftigte sich in seinem Vortrag „Verworrene Marktprozesse treiben Kosten hoch“ mit den alltäglichen Herausforderungen in der Marktkommunikation. „Wer mich kennt, weiß, ich meckere gern“, gab er freimütig zu, doch das nicht ohne Grund. In anderen Ländern komme die Marktkommunikation mit deutlich weniger Regularien aus und setze Änderungen schneller um. „Wir machen uns hier das Leben schwer, anstatt den Nutzen in den Vordergrund zu stellen“, stellte er fest. Ein Beispiel sei die teure, nicht wirklich durchgehend stabile AS4-Umsetzung. Auch die Implementierung des 24-Stunden-Lieferantenwechsels verlaufe noch holprig, vereinfache aber zumindest Kundenanmeldungen, da Stammdaten nun nachgeliefert werden können.
Foto: Oliver Kunz beim edna Fachtreffen
Ein weiteres Problem seien fehlende funktionierende Softwarelösungen im Markt, wodurch Prozesse scheitern: „Einspeiseranmeldungen gehen zu 90 Prozent schief“, so Kunz. Auf der anderen Seite fehlten aber auch Sanktionen durch die Bundesnetzagentur bei Verstößen durch Marktteilnehmer. Weitere Problemfelder fänden sich im Datenschutz, in der unsicheren Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers („ein gefährlicher Business Case“), der Frage der Datenhoheit bei der sternförmigen Messwertverteilung sowie in „Bruchstellen“ in den Softwareschnittstellen der Übertragungsnetzbetreiber: „Das hat nichts mehr mit Effizienz, Sinn und Zweck zu tun.“
Kunz plädierte für Vereinfachungen in den Regularien und freute sich zumindest über die langfristige Abschaffung der Mehr- und Mindermengenabrechnung. Kritik übte er auch am Konzept des neuen MaBiS-Hubs: „Hier werden einfach Prozesse oder Datenformate neu gebaut, die zum Teil wirklich heute schon hochautomatisiert funktionieren. Die Probleme von heute gibt es zukünftig ebenso oder könnten durch Einführungsprobleme sogar noch mehr werden.“
Lars Plagemann (regiocom) berichtete im Anschluss über eine „Zentrale Reporting Plattform als Beitrag zum Bürokratie-Abbau“. Gemeint war damit unter anderem ein zentraler Data-Hub der Bundesnetzagentur, der Marktdaten aggregieren soll, insbesondere solche mit Meldepflicht. Basis sei das Eckpunktepapier „Festlegung zur Herausgabe von Energiemarktdaten zur Weitergabe und Information nach § 111g EnWG (HEDWIG)“. Behörden sollen darauf zugreifen können und Mehrfachberichte somit bestenfalls vermieden werden. Der Leidensdruck in der Energiewirtschaft sei hoch, berichtete Plagemann. Die Branche müsse rund 15.500 Normen, Gesetze und Vorschriften beachten. Pro Jahr fließen mehr als 18 Millionen Arbeitsstunden nur in bürokratische Aufgaben, was rund 1,5 Milliarden Euro Kosten verursache.
Weitere vergleichbare Plattformen seien der MaBiS-Hub und SMARD 2.0. Gut umgesetzt, böten diese Plattformen Chancen für die Vereinfachung von Berichtspflichten, den Bürokratieabbau, zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Energiemarkt, zur Hebung von Synergien sowie für die Etablierung gemeinsamer Datenstandards. Umfangreiche Festlegungsinhalte, Datenkategorien und ‑formate seien bereits in der Entwicklung, doch es gelte auch noch, Sicherheitsbedenken auszuräumen und Redundanzen zu vermeiden.
Dr. Ralf Walther näherte sich dem Thema Regulatorik im Beitrag „Dynamische Tarife, Prosumer, Smart Meter: Wieviel Regulatorik braucht die Energiewende?“ von der technischen Seite. Die Digitalisierung des Zählerwesens in Deutschland sei rückständig, stellte er fest, in Skandinavien sei man wesentlich weiter. Regulierung sei zwar wichtig, um den Energiemarkt sicher und zuverlässig zu gestalten. Doch in der Praxis blockierten überzogene Anforderungen einen kosteneffizienten Ausbau. In ganz Deutschland seien gerade einmal 900 durch den Verteilnetzbetreiber steuerbare Smart Meter verbaut worden – bei rund 50 Millionen Zählpunkten. „Und dafür feiert sich die Branche dann auf LinkedIn“, bemerkte er. Auch rund 26 Millionen verbaute moderne Messeinrichtungen hätten praktisch keinen Nutzen, da nicht einfach auf die Infrarotschnittstellen zugriffen werden könne und vor allem Nutzungsmodelle fehlten. Sein Urteil: „Plastik, das keiner nutzt.“
Als Übergangslösung schlug er eine Erweiterung bestehender mME mit Uhr und Funkmodul vor: „Macht es doch kosteneffizient nach europäischem Standard!“ Dürften die so erweiterten Zähler Daten in die Marktkommunikation einspeisen, wären viele Nutzungsmöglichkeiten offen. „Warum muss das Gateway unbedingt ein iMSys-Gateway sein?“ warf er in den Raum. Von den erhobenen Daten würden auch Netzbetreiber profitieren, die sich ein viel besseres Bild von ihrem gesamten Netzzustand machen könnten, bis hin zur Überprüfung, ob einzelne Balkonkraftwerke wirklich mit Nulleinspeisung betrieben werden oder ein Haushalt mit PV-Erzeugung und Wallbox noch in das Standardlastprofil passt.
Zum Abschluss berichtete Michael Grosse (beegy) im Vortrag „HEMS und Regulierung: Mit neuem Geschäftsmodell die Digitalisierung der Energiewende vorantreiben“ über die technische Vernetzung von Wallboxen, Wärmepumpen, Photovoltaik und Speichern mittels eines Home Energy Management Systems. Besonderes Augenmerk richtete er auf die notwendigen Sicherheitsmechanismen, wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Trennung vom heimischen Netzwerk des Kunden, das möglicherweise sicherheitskritische Komponenten wie beispielsweise ungesicherte Überwachungskameras eingebunden hat.
Eine Kompromittierung einzelner Geräte lasse sich nicht grundsätzlich verhindern, so müsse man die Kommunikation zu Wechselrichtern oder Batterien öffnen, die ihrerseits in Hersteller-Clouds eingebunden sind. An dieser Stelle könne man sich dem Kundenwunsch und der Anbietermacht nicht verschließen. Eine völlige Sicherheit könne ohnehin niemand garantieren, betonte er, insbesondere wenn möglicherweise staatliche Akteure im Spiel seien. Und selbst bei einer vollständigen Absicherung des Systems blieben andere Angriffsvektoren. Ein denkbares Szenario wäre die Manipulation von Preissignalen, auf die HEMS automatisiert reagieren. Sicherheit lasse sich somit nicht per Verordnung herstellen. Grosse resümierte: „Wir brauchen Regulierung, aber keine Überregulierung.“
Die Veranstaltung zeigte, dass es aktuell viele Problemfelder im stark regulierten Energiemarkt gibt, aber mindestens genauso viele Lösungsvorschläge. Wenn die Politik in manchen Aspekten mehr Pragmatismus walten ließe und sich regelmäßig mit den Marktakteuren austauschen würde, könnten viele Veränderungen schneller umgesetzt werden. Der Austausch innerhalb des Verbands kann hier wertvolle Impulse liefern.